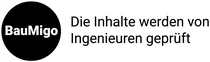Erstelldatum: 15.05.2020
Letzte Bearbeitung: 27.05.2021
Mit der Familie gemütliche Stunden vor einem brennenden Feuer zu verbringen während es draußen regnet, stürmt oder schneit – das ist für viele Menschen der Inbegriff von Gemütlichkeit. Viele Hausbesitzer wünschen sich daher einen Kamin. Doch wie funktioniert so ein Kamin eigentlich? Auf einer offenen oder geschlossenen Feuerstelle werden Holz, Kohle oder Briketts verbrannt. Die dabei entstehenden Verbrennungsgase werden über einen Schornstein nach außen befördert. Da Warmluft eine geringere Dichte als Kaltluft besitzt, die sich außerhalb des Gebäudes befindet, wird im Inneren des Kamins ein Unterdruck (Bernoullischer Effekt) aufgebaut und frische Luft für den Verbrennungsvorgang angesaugt. Dieses auch als Kamineffekt bekannte Prinzip sorgt dafür, dass die Rauchgase über den Schornstein entweichen können.
Der Kaminofen als Highlight jedes Wohnraums – doch welcher ist der Richtige?
Ein Kamin muss zunächst von einem Ofen unterschieden werden, der freistehend nicht zum Gebäude gehört. Als fester Bestandteil des Hauses oder der Wohnung ist der Kaminofen somit im Haus integriert und wird durch Wärmedämmung zum Schutz angrenzender Bausubstanz vom Gefüge der Wand umschlossen. Je nach Bauart kann der Kamin somit an einer Ecke als Eckkamin platziert werden oder an der glatten Wand mit einer offenen oder geschlossenen Feuerstelle nach vorne. Entscheidend für die Art der Nutzung dieser Feuerstelle ist deren Wirkungsgrad, der bei einem offenen Kamin ausschließlich zum Zuheizen oder für dekorative Zwecke genutzt werden kann. Mit der Planung eines Kamins sollten Sie sich als Hausbesitzer somit zunächst die Frage beantworten, welche Funktion die Feuerstelle ausfüllen soll. Als Heizsystem werden vier Arten der Ofenwärme voneinander unterschieden:
- Der Kamin als offene und geschlossene Heizfläche weist nur eine Energieeffizienz von 50 bis 80 % auf und dient vor allem als dekoratives Feuererlebnis mit dem Flammenspiel. Die Wärmeabgabe wird hauptsächlich durch die Ausführung und das Ummantelungsmaterial bestimmt.
- Der Kachelofen ist ein Speicherofen mit jahrhundertealter Tradition. Als freistehende Heiztechnik gilt der Ofen als eine sparsame und umweltfreundliche Alternative zu anderen fossilen Heizsystemen. Mit der Ummantelung und Glasur ist der Ofen zudem ein dekorativer Hingucker.
- Der Specksteinofen ist vor allem aufgrund seiner hohen Wärmespeicherkapazität gefragt, welche die Wärme über Stunden kontinuierlich in den umgebenden Wohnraum abgeben kann. Oftmals reicht es den Ofen zweimal täglich zu befeuern, um selbst im Winter ausreichend Wärme zu erhalten.
- Der Pelletofen als Alternative zum Kaminofen ist ausschließlich für das Beheizen eines einzelnen Zimmers gedacht und funktioniert halbautomatisch mit einem integrierten Heizluftgebläse.
Was ist beim Kauf eines Kaminofens zu beachten?
Verschiedene Arten von Ofensystemen sind für verschiedene Anwendungsbereiche konzipiert worden. Allen Brennöfen gemein ist die Verwendung einer Brennkammer bzw. eines Feuerraumes, welcher zum Aufstellraum hin offen oder geschlossen sein kann und die Abgase mittels eines Schornsteines nach außen befördert.
Die brandschutztechnischen Voraussetzungen zur Nutzung eines offenen oder geschlossenen Kamins im Wohngebäude werden vom Gesetzgeber vorgegeben und durch den Schornsteinfeger abgenommen. Gesetzt den Fall, Sie möchten einen Specksteinofen zum Heizen benutzen, ist aufgrund seines hohen Gewichts zunächst die Statik zu überprüfen. Vor allem im Altbau ist die Statik oftmals nicht ausreichend tragfähig, sodass ein Specksteinofen nur aufgestellt werden kann, wenn beim Tragwerk nachgebessert wird. Außerdem sind notwendige Abstände den Sicherheitsdatenblättern des Herstellers zu entnehmen.
In den Wänden um den Kamin darf ausschließlich eine nicht brennbare Wärmedämmung verwendet werden. Im Zuge dessen ist es wichtig zu wissen, dass der Außenbereich eines Kamins vor Funkenflug geschützt und die Rohrführung des Kamins nicht durch Hohlräume geführt werden darf. Darüber hinaus muss das Abzugsrohr dicht sein und über eine gewisse Höhe verfügen, die genügend Zug und Unterdruck im Kamin erzeugt. Umgekehrt würden so Brenngase in den Wohnraum entweichen. Vor dem Erstbetrieb muss der Kamin vom Schornsteinfeger abgenommen werden, dessen Feuerstättenschau zwischen 40 und 150 € kosten kann.
Des Weiteren muss der Kamin regelmäßig gewartet und gereinigt werden, um seine Funktionstüchtigkeit aufrechtzuerhalten und zu garantieren. Dazu gehört sowohl das Reinigen des Rauchrohres, des Feuerraumes sowie der Kaminscheiben, die sich mit etwas Zeitungspapier und weißer Asche hervorragend säubern lassen. Zur Wartung des Kamins gehört außerdem, die Türdichtungen und andere Dichtungen regelmäßig zu warten.
Holz ist nicht gleich Holz – das richtige Brennholz für den Kamin

Die Art des Kaminofens entscheidet darüber, was verbrannt werden darf und was nicht. Neben Holz, welches sich in der Effektivität grundlegend unterscheiden kann, gehören zum möglichen Befeuerungsmaterial: Steinkohle oder Braunkohle, Torf, Briketts, Pellets und anderes organisches Material. Welches Brennmaterial schlussendlich genutzt werden darf, legt die Bundesimmissionsschutzverordnung für die Verwendung kleiner und mittlerer Feuerungsanlagen genauestens fest.
Das alles entscheidende Kriterium für die Verwendung einer bestimmten Holzart für die Verbrennung im Kamin ist dessen Brennwert. Dieser gibt an, wie viel Wärmeenergie vom Holz bei der Verbrennung abgegeben wird, welcher je nach Trocknungsgrad des Holzes variieren kann. Im Unterschied zum Heizwert wird beim Brennwert auch jene Wärmeenergie mitberücksichtigt, die z. B. bei einem Brennwertkessel durch die Wärmerückgewinnung aus den Verbrennungsgasen erschlossen wird.
| Holzfeuchte (w) | |
|---|---|
| 0 % | absolut trocken |
| 10 % | kammertrocken |
| 15 % | lufttrocken |
| 25 % | sommertrocken |
| 50 % | waldfrisch |
Die physikalische Grundeinheit des Brennwertes ist das Joule pro Kilogramm, welches auch als Kilowattstunde pro Kilogramm (kWh/kg) oder in Kilowattstunde pro Raummeter (kWh/rm) angegeben werden kann. In sog. Holzbrennwerttabellen wird dazu der Brennwert für unterschiedliche Brennholzarten in Abhängigkeit von der Holzfeuchte (w) angegeben.
Als Beispiel ändert sich somit der Brennwert der Eiche von 4,24 kWh/kg im absolut trockenen Zustand auf gerade einmal 2,11 kWh/kg, wenn das Holz waldfrisch ist. Dies allein begründet sich aus der Tatsache, dass für die Verdampfung des Wassers zunächst Energie aufgebracht werden muss. Es ergibt sich daraus folgendes Bild für die gängigsten Holzarten:
| absolut trocken | waldfrisch | |
|---|---|---|
| Esche | 4,04 kWh/kg | 2,01 kWh/kg |
| Ahorn | 3,68 kWh/kg | 1,84 kWh/kg |
| Buche | 4,41 kWh/kg | 2,20 kWh/kg |
| Birke | 3,95 kWh/kg | 1,97 kWh/kg |
| Linde | 4,53 kWh/kg | 2,26 kWh/kg |
| Erle | 4,30 kWh/kg | 2,15 kWh/kg |
| Weide | 4,14 kWh/kg | 2,06 kWh/kg |
| Kiefer | 4,95 kWh/kg | 2,47 kWh/kg |
| Fichte | 4,03 kWh/kg | 2,01 kWh/kg |
| Tanne | 3,81 kWh/kg | 1,90 kWh/kg |
Wie aus den Zahlen ersichtlich, eignet sich vom Brennwert her die Buche, die Linde sowie die Kiefer bestens für das Verbrennen im Kamin. Des Weiteren ist es ratsam, Holz nach Volumen einzukaufen statt nach Gewicht, da das Holz, falls es nachgetrocknet werden muss, an Volumen verliert. Und noch eins wird durch diese Tabelle klar: Egal, welches Holz verbrannt wird, es sollte trocken sein.